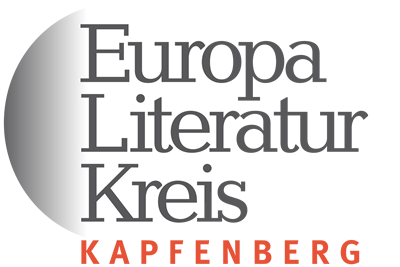Rezensionen und Lesetipps
An dieser Stelle weisen wir Sie auf Bücher hin, die auf verschiedensten Wegen zu uns gefunden haben.
Vielleicht können wir mit unseren Besprechungen Ihr Interesse wecken, sie ebenfalls zu lesen.
Rezensionen eingrenzen
Aus dem bayerischen Wald
von Emerenz MeierRezension von Reinhard Mermi
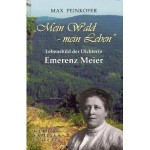 ... „das Dichterweib“, geboren 1874 in Schiefweg bei Waldkirchen in Niederbayern, war Wirts- und Bauerstochter und ist neben Lena Christ die bedeutendste bayerische Volksdichterin. In ihren gegenständlichen Texten beschreibt sie Menschen und Orte des Bayerischen Waldes, spürt Ungerechtigkeiten nach und rebelliert gegen Traditionen und Ungerechtigkeiten. Texte von ihr wurden u.a. im Simplicissimus und „Die fliegenden Blätter“ veröffentlicht. Im Herbst 1896 erschien im ostpreußischen Königsberg ihr erstes und einzigstes Buch „Aus dem bayerischen Wald“. Hans Carossa las das Buch und besuchte darauf hin im Herbst 1898 (zu Fuß) Emerenz Meier in Waldkirchen. Doch die sich abzeichnende schriftstellerische Karriere verlief anders:
... „das Dichterweib“, geboren 1874 in Schiefweg bei Waldkirchen in Niederbayern, war Wirts- und Bauerstochter und ist neben Lena Christ die bedeutendste bayerische Volksdichterin. In ihren gegenständlichen Texten beschreibt sie Menschen und Orte des Bayerischen Waldes, spürt Ungerechtigkeiten nach und rebelliert gegen Traditionen und Ungerechtigkeiten. Texte von ihr wurden u.a. im Simplicissimus und „Die fliegenden Blätter“ veröffentlicht. Im Herbst 1896 erschien im ostpreußischen Königsberg ihr erstes und einzigstes Buch „Aus dem bayerischen Wald“. Hans Carossa las das Buch und besuchte darauf hin im Herbst 1898 (zu Fuß) Emerenz Meier in Waldkirchen. Doch die sich abzeichnende schriftstellerische Karriere verlief anders:
Auch der Bayerische Wald blieb bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hin nicht von den Auswirkungen der Industrialisierung verschont. Es vollzog sich die schonungslose Umwandlung der bisherigen Agrargesellschaft hin zur Industriegesellschaft unserer Zeit. Emerenza Meier und ihre Familie wanderten 1906, wie so viele andere aus dem Bayerwald, nach Chicago aus.
Das Leben in der Fremde, der Kampf ums Überleben, ließen die Schriftstellerin schlussendlich verstummen. Fremd in der Fremde, mit Sehnsucht nach einer Heimat, die sie nirgendwo gefunden hat, starb Emerenz Meier 1928 in Chikago.
Es ist wieder mal an der Zeit, dass wir uns an diese Dichterin erinnern.
Wödaschwüln
von Emerenz Meier
Mi würgt der Wind, mi druckt der Tag -
Hü, meine Öchsl, hü!
Schwül wirds, es kimmt a Wödaschlag.
Hü, meine Öchsl, hü!
Der Acker hat an hirtn Bodn,
Der Mähnt* koan Gang, der Pfluag an Schodn -
Hü, meine Öchsl, hü!
Mi würgt der Wind, mi brennt der Tag!
Hott, meine Öchsl, hott!
Und daß mi 's Mensch iatzt nimmer mag? -
Hott, meine Öchsl, hott!
Es hat - i moan - sein guatn Grund,
Und wann i 'hn net derstich, den Hund,
Den schlechtn, straf mi Gott!
Mei Mensch is schö, drum gfallts eahm guat.
Wüah, meine Öchsl, wüah!
A Messer und fünf Stich gibt Bluat.
Wüah, meine Öchsl, wüah!
Zua bis aufs Heft und ummadraht,
Verfluachter Lump, wia wohl dös taat!
Wüah, meine Öchsl, wüah!
Und bist so schö, du schwarze Dirn,
Zauf, meine Öchsl, zauf!
Und hast so krauste Haar ums Hirn,
Zauf, meine Öchsl, zauf!
Und lachst so süaß und schaust so fei,
Und kannst so falsch und elend sei!
Zauf, meine Öchsl, zauf!
Mi würgt der Wind, mi brennt der Tag!
Aoh, meine Öchsl, aoh!
Muaß 's sein, daß i dös ewi trag?
Aoah, meine Öchsln, aoh!
Der Dunner kracht, es blitzt und brennt,
Schlag, Herrgott, ein und mach an End! -
Aoh, meine Öchsl, aoh!
Das schwarze Hotel
von Michael Arenz, Hansgert LambersRezension von Hans Bäck
expose-verlag.de ISBN 978-3-925935-82-4

Poeme (von Michael Arenz) und Fotografien (von Hansgert Lambers)
In Zeiten von Corona werden viele aufgeschobene Aufgaben oder Vorhaben hervorgeholt.
Sie liegen dann am Schreibtisch. Sei es nun ein Buch, das noch zu lesen wäre (eher selten) oder eine Rezension, die versprochen wurde (bereits häufiger), ein eigener Text, der zu bearbeiten wäre (sehr oft und dringend), oder auch ein Gedanke, dem nachzugehen wäre. Das kann dann ein Blick aus dem Fenster sein, wo ein kahler Ast darauf wartet, dass sich eine Amsel darauf niederlässt. Es sind aber auch solche Gedanken und Ideen, die beim Anhören von schöner und guter Musik entstehen. Wobei natürlich das Dilemma bereits beginnt: Was ist nun gute und schöne Musik? Für jeden etwas anderes, ganz klar. Für mich eingeschränkt aber keinesfalls reduziert. “Mein“ Musikbogen reicht von ganz früh (so um 1300 herum) bis ganz nah an die Gegenwart heran. Doch ist das nur ein Einwurf in diesem Text gewesen, da mich das Entstehen von Gedanken dazu verführt hat und ich, während diese Zeilen entstehen, nebenbei (darf man das?) Musik höre, und zwar schmachtet ein Tenor in schönstem Italienisch von der Liebe. So, und unter diesen Begleitumständen, soll nun eine Rezension entstehen. Noch dazu zu dem neuen gemeinsamen Werk von Michael Arenz und Hansgert Lambers. Die Poeme, Gedichte, Erzählungen von Michael Arenz verfolge ich schon lange, da er ein regelmäßig im „Reibeisen“ veröffentlichender Autor ist. Eine treue Seele sozusagen. Und da ich bereits einige Bücher der beiden kongenialen Partner Arenz und Lambers vorliegen habe, ist mir auch der Fotograf kein Unbekannter mehr.
Doch immer wieder ist es neu, mit den Beiden auf Entdeckungsreise zu gehen. Wenn Arenz davon schreibt, dass „Gemütlichkeit im Wandel der Zeiten“ (Seite 17) darin besteht, dass einer noch seine Stammkneipe aufsuchen kann, sein „Bier in Gesellschaft zu trinken, ohne dieser Gesellschaft angehören zu müssen“ so bekommt der Corona-geplagte im Homeoffice sitzende Autor ein wenig Heimweh nach dieser Gemütlichkeit. Auch wenn das geschilderte Bild alles andere als gemütlich ist. Doch das ist der Grundton der sich durchzieht: Sowohl die Fotos als auch die Texte, sind Zeichen einer kaputtgehenden Welt. Nein, Hoffnung, Zuversicht, da muss man lange suchen und sorgfältig blättern! Womöglich hält der Autor das Poem auf Seite 39 „Gerettet“ für einen solcher seltenen Hoffnungsschimmer: „… aber nicht im entferntesten begreifen konnte.“ Seite 49 „Guten Tag“ zeigt den Autor als genauen Beobachter und Hundeversteher, aber der Begegnende „hebt den Arm zum Gruß, nie ohne ein Lächeln“.
Aber, „wir werden kein Gespräch mehr beginnen, unsere Worte sind schon lange fort“ dann folgt eine Reihe von Fotos, die eine absurde Schönheit zeigen könnten, wenn man darauf erpicht ist, solche auch im Verfall zu sehen. Dann folgt wieder auf Seite 80 ein Text „in dem es sich niemand leisten kann, mit einem freundlichen Gesichtsausdruck erwischt zu werden“ und nüchtern wird uns mitgeteilt, dass „Nachts sind die Friedhöfe geschlossen…“ (Seite 93). Den „Tiefpunkt“ der menschlichen Psyche und damit einen Höhepunkt der poetischen Inhalte dieses grandiosen Buches finde ich dann auf Seite 119 „Antoine et Arlette“ diesem Poem ist nichts mehr hinzuzufügen!
Noch etwas zum Fotografen, zu den Fotos. Stadtlandschaften, Straßenfotografien, unglaubliche Brandmauern oder unbebaute Grundstücke, bei denen der Betrachter sich fragt: „Vor wie vielen Jahrzehnten das aufgenommen sei.“ Lambers nennt manche seiner Arbeiten bezeichnend „Seitenblicksfotografien“ wobei man dabei sichergehen kann, dass dies nichts mit der unerträglichen Fernsehsendung diesen Namens zu tun hat. Ich zitiere aus dem Nachwort von Axel Sommer (Seite 130): „ein Konzept der Konzeptlosigkeit, ein Konzept des Absichtslosen“ verfolgt. Oder, prägnant formuliert: „einen Blick ohne Umwege zum Bild werden lassen.“
Lieferbar ist das Werk über die beiden Autoren oder über den Fotoverlag von Hansgert Lambers www.expose-verlag.de ISBN 978-3-925935-82-4
Hans Bäck
Nichts wird so bleiben, wie es war?
von Ulrike GuèyrotRezension von Hans Bäck
Molden Verlag
ISBN 978-3-222-15062-3
Unwillkürlich fragt man, warum noch ein Buch, ein Artikel, ein Essay, das sich mit der Zeit nach Corona beschäftigt? Beiträge, mehr oder weniger klug und fundiert, manche an den Haaren herbeigezogen in den Schlussfolgerungen, etliche lesenswert, werden täglich neu auf den Tisch gelegt.
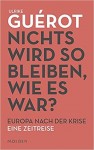 Und nun das schmale Buch aus dem Moldenverlag der Autorin, die u. a. Professorin an der Donau-Universität Krems ist. Auf knapp 100 Seiten reißt sie die Probleme Europas schonungslos auf. Nicht erst seit Corona, die Wurzen liegen tiefer. Die Frage wird aufgeworfen, ob es nicht höchst an der Zeit wäre, die europäische citicenship zu aktivieren und die Artikel 17- 22 der EUV endlich ernst zu nehmen. Damit würden viele zusammenhängende Aufgaben plötzlich virulent: Die europäische Arbeitslosenversicherung, die europäische Sozialgesetzgebung, die europäische Mindestsicherung und vieles mehr. Das ist so viel, dass es den Eindruck erweckt, es würde noch 20 Pandemien brauchen, um all dies zu realisieren. Doch halt! Die Autorin sieht Wege, Möglichkeiten, da voran zu kommen. Und sie zeigt auch auf die beharrenden, die bremsenden Politiker, sie teilweise sogar beim Namen nennend. Schön und gut, Utopien werden gebraucht um Realitäten zu verändern, das war schon in den Anfängen der Europäischen Einigung so und wird es auch in Zukunft so sein. Die aufgezeigten „Utopien“ sind, wenn man das Plädoyer Guèrots verfolgt, gar nicht so unglaublich und realitätsfern. Es bedürfte nur einiger Kleinigkeiten, wie beispielsweise, das Zurückstellen der nationalen Interessen im Rat, in der Kommission, im Europäische Parlament und stattdessen mehr europäisch zu denken. Das allerdings, so der Befund der Autorin, ist derzeit in weite Fernen gerückt. Doch sie gibt die Hoffnung nicht auf, im letzten Kapitel entwirft sie eine Möglichkeit, die bestechend erscheint – der europäische Bürger wird wach und mündig und nimmt dieses Europa in die Hand, es entsteht nicht eine ‚karge EU, sondern eine wirkliche europäische Gemeinschaft.’ Spätestens an dieser Stelle stockt die bisher vorbehaltslose Zustimmung des Rezensenten. Als „Spätgeborener“ (Jg. 1940) wurde die Entstehung Europas miterlebt und da ist die Erinnerung vorhanden, dass von Anfang an nicht die Bewegung von „unten“ vom Bürger, vom „Volk“, vom Wähler kam. Es waren ganz einfach „weise alte Männer“ rechts und links des Rheins, die Taten setzten. Und nun ist eine weitere Bemerkung des Rezensenten fällig: Es ist ärgerlich und störend beim Lesen die blöden * in Wörtern wie Bürger*innen, Europäer*innen vorzufinden. Was soll das aussagen? Die Frauen unserer Gesellschaft haben es doch nicht mehr notwendig so verballhornt aufzuscheinen! Ich wiederhole daher mit einem gar nicht wertfreien Unterton: Das Europa, wie wir es bis heute erleben durften, wurde von weisen alten Männern erdacht und geschaffen. Und es ist leider eine Tatsache, dass die größten Probleme der heutigen Union auf zwei Sätze von zwei Frauen zurückzuführen sind: Der erste Satz: „I want back my money!“ Damit hat Magret Thatcher für alle Zeiten den nationalen Poker um Eigenheiten, Eigenständigkeiten, um eigene Wege eröffnet. Und der zweite Satz war nicht minder verhängnisvoll: „Wir schaffen das!“ Fr. Merkel hat sich dadurch die AfD in den Bundestag geholt, die Rechtsextremen in ganz Europa aufmunitioniert, das Entstehen von Parallelgesellschaften nicht nur in den deutschen Großstädten ermöglicht. Ja, auch die Sonderwege von Polen und Ungarn gefördert oder zumindest realisierbar gemacht. Natürlich, bei diesen Staaten kommt noch dazu, das durch die Überheblichkeit der jungen, europäischen Eliten, deren Wahlenthaltungen (wozu sollen wir wählen gehen?) genau jene Kräfte die Überhand bekamen, die heute und in den nächsten Jahren das Europäische Projekt erschweren werden. Es gibt zu viele Baustellen in und bei Europa, dass es nach Ansicht des Rezensenten nicht genügen wird, mit der Europäischen Bürgerschaft das alles beheben zu wollen. Da wird unendlich viel und harte Arbeit notwendig werden, wenn die Corona-Pandemie dazu einen Anstoß geben kann, sollten wir einigermaßen zuversichtlich den nächsten drei Jahren entgegenblicken können. Und hoffen, dass es wieder ein paar weise alte Männer (und durchaus auch Frauen) gibt, welche die Utopien mit der notwendigen Pragmatik angehen. Und da bin ich zuversichtlich, dass auch die Jungen Europäer dies erkennen und mitmachen. Es ist ja deren Europa!
Und nun das schmale Buch aus dem Moldenverlag der Autorin, die u. a. Professorin an der Donau-Universität Krems ist. Auf knapp 100 Seiten reißt sie die Probleme Europas schonungslos auf. Nicht erst seit Corona, die Wurzen liegen tiefer. Die Frage wird aufgeworfen, ob es nicht höchst an der Zeit wäre, die europäische citicenship zu aktivieren und die Artikel 17- 22 der EUV endlich ernst zu nehmen. Damit würden viele zusammenhängende Aufgaben plötzlich virulent: Die europäische Arbeitslosenversicherung, die europäische Sozialgesetzgebung, die europäische Mindestsicherung und vieles mehr. Das ist so viel, dass es den Eindruck erweckt, es würde noch 20 Pandemien brauchen, um all dies zu realisieren. Doch halt! Die Autorin sieht Wege, Möglichkeiten, da voran zu kommen. Und sie zeigt auch auf die beharrenden, die bremsenden Politiker, sie teilweise sogar beim Namen nennend. Schön und gut, Utopien werden gebraucht um Realitäten zu verändern, das war schon in den Anfängen der Europäischen Einigung so und wird es auch in Zukunft so sein. Die aufgezeigten „Utopien“ sind, wenn man das Plädoyer Guèrots verfolgt, gar nicht so unglaublich und realitätsfern. Es bedürfte nur einiger Kleinigkeiten, wie beispielsweise, das Zurückstellen der nationalen Interessen im Rat, in der Kommission, im Europäische Parlament und stattdessen mehr europäisch zu denken. Das allerdings, so der Befund der Autorin, ist derzeit in weite Fernen gerückt. Doch sie gibt die Hoffnung nicht auf, im letzten Kapitel entwirft sie eine Möglichkeit, die bestechend erscheint – der europäische Bürger wird wach und mündig und nimmt dieses Europa in die Hand, es entsteht nicht eine ‚karge EU, sondern eine wirkliche europäische Gemeinschaft.’ Spätestens an dieser Stelle stockt die bisher vorbehaltslose Zustimmung des Rezensenten. Als „Spätgeborener“ (Jg. 1940) wurde die Entstehung Europas miterlebt und da ist die Erinnerung vorhanden, dass von Anfang an nicht die Bewegung von „unten“ vom Bürger, vom „Volk“, vom Wähler kam. Es waren ganz einfach „weise alte Männer“ rechts und links des Rheins, die Taten setzten. Und nun ist eine weitere Bemerkung des Rezensenten fällig: Es ist ärgerlich und störend beim Lesen die blöden * in Wörtern wie Bürger*innen, Europäer*innen vorzufinden. Was soll das aussagen? Die Frauen unserer Gesellschaft haben es doch nicht mehr notwendig so verballhornt aufzuscheinen! Ich wiederhole daher mit einem gar nicht wertfreien Unterton: Das Europa, wie wir es bis heute erleben durften, wurde von weisen alten Männern erdacht und geschaffen. Und es ist leider eine Tatsache, dass die größten Probleme der heutigen Union auf zwei Sätze von zwei Frauen zurückzuführen sind: Der erste Satz: „I want back my money!“ Damit hat Magret Thatcher für alle Zeiten den nationalen Poker um Eigenheiten, Eigenständigkeiten, um eigene Wege eröffnet. Und der zweite Satz war nicht minder verhängnisvoll: „Wir schaffen das!“ Fr. Merkel hat sich dadurch die AfD in den Bundestag geholt, die Rechtsextremen in ganz Europa aufmunitioniert, das Entstehen von Parallelgesellschaften nicht nur in den deutschen Großstädten ermöglicht. Ja, auch die Sonderwege von Polen und Ungarn gefördert oder zumindest realisierbar gemacht. Natürlich, bei diesen Staaten kommt noch dazu, das durch die Überheblichkeit der jungen, europäischen Eliten, deren Wahlenthaltungen (wozu sollen wir wählen gehen?) genau jene Kräfte die Überhand bekamen, die heute und in den nächsten Jahren das Europäische Projekt erschweren werden. Es gibt zu viele Baustellen in und bei Europa, dass es nach Ansicht des Rezensenten nicht genügen wird, mit der Europäischen Bürgerschaft das alles beheben zu wollen. Da wird unendlich viel und harte Arbeit notwendig werden, wenn die Corona-Pandemie dazu einen Anstoß geben kann, sollten wir einigermaßen zuversichtlich den nächsten drei Jahren entgegenblicken können. Und hoffen, dass es wieder ein paar weise alte Männer (und durchaus auch Frauen) gibt, welche die Utopien mit der notwendigen Pragmatik angehen. Und da bin ich zuversichtlich, dass auch die Jungen Europäer dies erkennen und mitmachen. Es ist ja deren Europa!
Hans Bäck
Politiker in drei Hinsichten
von Reinhard GrossmannRezension von Hans Bäck
Roman
Elbaol-Verlag Hamburg
ISBN 978-3-939771-81-4
Diese Rezension muss ich ein wenig anders beginnen, als dies normalerweise der Fall ist.
Es war eine Lesereise von Mitgliedern des Europa Literaturkreises Kapfenberg u. a. nach Hamburg und Schleswig Holstein. In der wunderschönen Landeshauptstadt Kiel setzte sich eines Vormittags ein kleiner, älterer Herr zu uns, stellte sich als der Autorenkollege Reinhard Grossmann vor. Wir sprachen über Literatur, die Probleme der Schreibenden, über Gott und die Welt. Am Abend bei der Lesung im Literaturhaus Kiel sorgte Reinhard mit seiner Teilnahme für eine erhebliche Vergrößerung der Besucherzahl! Jedenfalls, wir haben einander kennen gelernt, Gefallen und Sympathie gefunden. Durch die Entfernung, Kiel ist von der Obersteiermark aus gesehen doch am anderen Ende der Welt, blieben die Kontakte aber spärlich. Es gab hin und wieder etwas zu lesen – vor allem von Reinhard. So, und nun legt er ein neues Buch vor, und siehe da, auf der Seite 253 ist eine Bibliografie abgedruckt, die zeigt, wie fleißig Reinhard in all den Jahren war. Nein, nicht in all den Jahren, die Bibliografie setzt ein mit dem Jahr 2010, also hatte der Autor damals bereits 76 Lebensjahre „hinter sich“. So betrachtet, ist das Pensum enorm!
Wie gesagt, einzelne Erzählungen des Autors waren bekannt, hatten wir gelesen, auch im Reibeisen abgedruckt. Daher war die Spannung groß, seinen insgesamt vierten Roman (alles seit 2010!!) zu lesen.
Soweit einmal eine unkonventionelle Einleitung zu einer Rezension.
 Der Lebenslauf eines Politikers wird nachgezeichnet. Erst einmal aus der Erzählperspektive des Schulfreundes, der den Politiker von der Sandkiste an begleitet und erlebt hatte. Ein wenig denkt der Rezensent bei der Schilderung an Machiavelli, so wie der Politiker seinen Aufstieg minutiös plant. Es ist natürlich zu überlegen – und bei der Lektüre stellt sich diese Frage mehrmals – ob sich eine politische Karriere so genau planen und umsetzen lässt. Das ist so gestaltet, dass ein Schritt zwangsläufig den nächsten nach sich zieht (ziehen muss). Dieses Kapitel ist übertitelt mit „Der Regierungschef“ also darf dem Leser verraten werden, dass der geschilderte Politiker sein Planungsziel erreicht. Dabei ist aber nicht zu erwarten, dass tiefvergrabene Erkenntnisse, Geheimnisse aus der Niederungen der Hohen Politik verraten werden. Der Autor war selbst einige Jahre als Regionalpolitiker tätig, es hätte ja sein können, dass er diesen Roman zum Anlass nimmt um „auszupacken“. Reinhard Grossmann wählt eine ganz andere Lösung für den Roman-Verlauf. Der Politiker, inzwischen Regierungschef und Schwager des Schulfreundes/Autors entscheidet sich anlässlich einer Geburtstagfeier zum Fünfziger, einen ganz anderen Weg zu gehen. Mit einem unglaublichen Programm zur Änderung der Mobilität stößt er alle vor den Kopf. Doch wie diese Entwicklung weitergeht, wie sich die Situation zuspitzt, das verrate ich nicht, das sollen Sie, liebe Leser, selbst erkunden.
Der Lebenslauf eines Politikers wird nachgezeichnet. Erst einmal aus der Erzählperspektive des Schulfreundes, der den Politiker von der Sandkiste an begleitet und erlebt hatte. Ein wenig denkt der Rezensent bei der Schilderung an Machiavelli, so wie der Politiker seinen Aufstieg minutiös plant. Es ist natürlich zu überlegen – und bei der Lektüre stellt sich diese Frage mehrmals – ob sich eine politische Karriere so genau planen und umsetzen lässt. Das ist so gestaltet, dass ein Schritt zwangsläufig den nächsten nach sich zieht (ziehen muss). Dieses Kapitel ist übertitelt mit „Der Regierungschef“ also darf dem Leser verraten werden, dass der geschilderte Politiker sein Planungsziel erreicht. Dabei ist aber nicht zu erwarten, dass tiefvergrabene Erkenntnisse, Geheimnisse aus der Niederungen der Hohen Politik verraten werden. Der Autor war selbst einige Jahre als Regionalpolitiker tätig, es hätte ja sein können, dass er diesen Roman zum Anlass nimmt um „auszupacken“. Reinhard Grossmann wählt eine ganz andere Lösung für den Roman-Verlauf. Der Politiker, inzwischen Regierungschef und Schwager des Schulfreundes/Autors entscheidet sich anlässlich einer Geburtstagfeier zum Fünfziger, einen ganz anderen Weg zu gehen. Mit einem unglaublichen Programm zur Änderung der Mobilität stößt er alle vor den Kopf. Doch wie diese Entwicklung weitergeht, wie sich die Situation zuspitzt, das verrate ich nicht, das sollen Sie, liebe Leser, selbst erkunden.
Der zweite Teil des Romans schildert den Lebensweg aus der Sicht der Tochter. Krampf- ja fast zwanghaft bemüht sie sich, nicht als DIE Tochter des berühmten Vaters zu gelten und allein, aus eigenem Können, mit eigenen Methoden, ihre Lebensaufgabe zu erfüllen. Die sie dann aber doch wieder in der Nachfolge des Vaters sieht. Die Politik von der wissenschaftlichen Seite her beeinflussen, Ergebnisse auf diese Weise erzielen? Der Abnabelungsprozess dauert an, wird auch durch die Gesellschaft immer wieder verzögert, - „ach Sie, die Tochter des früh verstorbenen Ministerpräsidenten“ – doch es gelingt ihr letztlich doch. Klar, die Zeit geht weiter und vergeht, und es kommt jene Phase wo der Name des Vaters nur noch ein ferner Nachklang ist. Spannend, wie die Mutter in das nun auch politische Leben der Tochter nicht eingreift.
Und erst in der nächsten Generation, im Enkelsohn gelingt anscheinend die komplette Abwendung von der Politik, wenn man davon absieht, dass dieser Enkelsohn als Komponist politische Musik im Stil von Johann Sebastian Bach schreibt.
Reinhard Grossmann hat einen Roman vorgelegt, der einen großen Zeitrahmen umfasst und daher auch zeitgeschichtlich gesehen werden könnte. Natürlich steht die politische Betrachtung der handelnden Personen im Vordergrund des Geschehens und doch sind die menschlichen Aspekte, die Zwischen-Schichten schön geschildert. Vielleicht geht an einigen Stellen der Autor zu rasch wieder an den Hauptstrang der Erzählung zurück, während der Leser lieber bei Schilderungen des Umfeldes verbleiben möchte, doch ist das Ansichtssache des Rezensenten. Dessen Restfrage bleibt unbeantwortet, ist es in der realen Politik, im harten politischen Tagesgeschehen tatsächlich möglich, eine Karriere so exakt zu planen und durchzuführen, wie es die Hauptperson des Romans, der Frank Welzin geschafft hat? Doch das ist das Vorrecht der Autoren, so etwas auch zu erfinden. Und ich finde es ist ganz gut erfunden.
Hans Bäck
Kinderbomber, Moorsoldat
von Christine TeichmannRezension von Hans Bäck
Roman, Edition Keiper
ISBN 978-3-903322-15-8
 Eine Geschichte wird erzählt, die ihren Ausgang in „fernen Zeiten und in fernen Landen“ nimmt, dann urplötzlich in eine gerade erst zurückliegende Vergangenheit mündet. 1933 wird der 17 jährige Jung-Kommunist Emil-Manoli Fischer ins KZ Börgermoor im Emsland inhaftiert. Er erlebt die „Geburt“ des Liedes der Moorsoldaten, kommt frei, zurück nach Österreich, wird zwangsläufig „Ostmärker“, an die Ostfront einberufen, gerät in sowjetische Gefangenschaft, lernt den kommunistischen Lagerterror genauso kennen wie Jahre zuvor den faschistischen im KZ. Verbringt seine letzte Lebenszeit in einem Alten- und Pflegeheim. Dabei begegnet er einer Mutter zweier Kinder: Marlies mit dem 17 jährigen Theo und der 13 jährigen Claudia. Marlies ist an MS erkrankt und wir können/dürfen miterleben, wie die Schübe ihre Lebensumstände zusehends verschlechtern. Und dabei wäre gerade jetzt die Anwesenheit der Mutter in der Familie so notwendig. War es doch immer sie, welche die Familie zusammengehalten hat, dafür sorgte, dass die Kinder ordnungsgemäß linkslink erzogen werden. So auf die Art: Das wird erwartet, das ist notwendig. WARUM das notwendig sei, wird nie hinterfragt. Daher dauert es nicht lange bis der Sohn Theo in der Schule Stunk macht, „Kanaken“ verprügelt, mit schweren Stiefeln und Kurzhaarschnitt auftaucht. Der Vater, sehr klischeehaft, ist total beschäftigt, hastet von einer Baustelle zur anderen, hat ständig damit zu tun, dass dort nie etwas so klappt wie es soll und geplant war. Telefonate mit dem Sohn eigentlich unmöglich, denn entweder in einer Besprechung oder auf der Fahrt. Wie soll der Vater auf den Sohn einwirken, seine schulischen Fortschritte überwachen, beaufsichtigen? Unmöglich, dazu war immer die Mutter da, doch jetzt, nach einem neuerlichen Schub? Und diese im Heim, mit dem uralten Emil/Manoli im Gespräch über KZ, Kommunismus, verlorene Jugend.
Eine Geschichte wird erzählt, die ihren Ausgang in „fernen Zeiten und in fernen Landen“ nimmt, dann urplötzlich in eine gerade erst zurückliegende Vergangenheit mündet. 1933 wird der 17 jährige Jung-Kommunist Emil-Manoli Fischer ins KZ Börgermoor im Emsland inhaftiert. Er erlebt die „Geburt“ des Liedes der Moorsoldaten, kommt frei, zurück nach Österreich, wird zwangsläufig „Ostmärker“, an die Ostfront einberufen, gerät in sowjetische Gefangenschaft, lernt den kommunistischen Lagerterror genauso kennen wie Jahre zuvor den faschistischen im KZ. Verbringt seine letzte Lebenszeit in einem Alten- und Pflegeheim. Dabei begegnet er einer Mutter zweier Kinder: Marlies mit dem 17 jährigen Theo und der 13 jährigen Claudia. Marlies ist an MS erkrankt und wir können/dürfen miterleben, wie die Schübe ihre Lebensumstände zusehends verschlechtern. Und dabei wäre gerade jetzt die Anwesenheit der Mutter in der Familie so notwendig. War es doch immer sie, welche die Familie zusammengehalten hat, dafür sorgte, dass die Kinder ordnungsgemäß linkslink erzogen werden. So auf die Art: Das wird erwartet, das ist notwendig. WARUM das notwendig sei, wird nie hinterfragt. Daher dauert es nicht lange bis der Sohn Theo in der Schule Stunk macht, „Kanaken“ verprügelt, mit schweren Stiefeln und Kurzhaarschnitt auftaucht. Der Vater, sehr klischeehaft, ist total beschäftigt, hastet von einer Baustelle zur anderen, hat ständig damit zu tun, dass dort nie etwas so klappt wie es soll und geplant war. Telefonate mit dem Sohn eigentlich unmöglich, denn entweder in einer Besprechung oder auf der Fahrt. Wie soll der Vater auf den Sohn einwirken, seine schulischen Fortschritte überwachen, beaufsichtigen? Unmöglich, dazu war immer die Mutter da, doch jetzt, nach einem neuerlichen Schub? Und diese im Heim, mit dem uralten Emil/Manoli im Gespräch über KZ, Kommunismus, verlorene Jugend.
Theo wird vereinnahmt, kommt mit gut organisierten Rechten in Kontakt, die ihm eine Art Zuversicht zu geben scheinen, so lange er für diese nützlich sein könnte. Versuche der üblichen Institutionen dem Jungen eine Hilfe zu geben, scheitern fast erwartungsgemäß kläglich. Schuldirektor, Schulpsychologen, Mediatorin, letztlich auch der Versuch der Mutter den alten Emil/Manoli einzuschalten, als Zeitzeugen womöglich, wohin das führen könnte, selbst die Versuche der Schwester scheitern. Bis auf den Einfluss der neuen Gönner und Förderer. Es kommt was kommen musste: Theo wird verwendet um ein Bombenattentat auszuführen. Stümperhaft, gar nicht professionell, sodass die U-Haft die logische Folge ist. Nein, der Rezensent verrät nichts weiter, es soll ja dem Leser auch noch eine Spannung verbleiben. Interessant ist die Einbindung des uralten Moorsoldaten als hilfloser Versuch der Mutter, den Sohn damit auf den Weg zurück zu bringen. Die Geschichte der Moorsoldaten ist sehr gründlich recherchiert, spannend geschrieben, lesenswert.
Im Ganzen gesehen, eine aktuelle Beschreibung, wie das Umfeld in der Lage ist, junge Menschen mit den besten Voraussetzungen, so zu beeinflussen, dass von sämtlichen gutgemeinten Erziehungs-Ansätzen der Mutter nichts mehr übrig bleibt. Interessant auch eine Schlussfolgerung, die dem Theo in der U-Haft offeriert wird: „Das ist ein Angebot, das du überhaupt nicht verdienst. Du kannst unsere Großzügigkeit kennen lernen, aber du kannst es auch drauf ankommen lassen, unsere Macht zu spüren.“
Auf Seite 208 schildert die Autorin eine Situation, die sie womöglich herauf zu ziehen verspürt, die aber wahrscheinlich so doch nie Realität wird. Doch davon waren die alten Kommunisten auch überzeugt.
Hans Bäck
Einträge 41 bis 45 von 64 | Weitere ->